|
|
Schulprogramm 2001 |
|
|
|
|
|
|
Schulprogramm 2001 |
|
|
|
|
|
Unser Schulprogramm besteht aus Absprachen, Übereinkünften und Vereinbarungen über unser Schulleben, welche von Eltern und Lehrerkollegium festgelegt worden sind. Es ist ein verbindliches Programm, das aber regelmäßig fortgeschrieben wird. Das Schulprogramm soll
|
|
|
1. |
|
19. |
||
|
2. |
|
20. |
||
|
3. |
|
21. |
||
| 4. | Begegnung mit Sprachen | 22. | Religiöse Aktivitäten | |
|
5. |
|
23. |
||
| 6. | Bildungspläne | 24. | ||
|
7. |
|
25. |
||
|
8. |
|
26. |
||
|
9. |
|
27. |
||
|
10. |
|
28. |
||
|
11. |
|
29. |
||
|
12. |
|
30. |
||
|
13. |
|
31. |
||
|
14. |
|
32. |
Unterrichtswerke | |
|
15. |
|
33. |
||
|
16. |
Kakaogeld |
|
34. |
|
|
17. |
|
35. |
||
|
18. |
|
36. |
|
|
In unserer Schule sind mehrere Formen einer Adventsfeier erprobt bzw. eingeführt. In den einzelnen Klassen finden in der Regel zum Unterrichtsbeginn kleine Adventsbesinnungen statt. |
|
|
Die Schul-Adventsfeier wird jeweils vom 2. und 4. Schuljahr gestaltet und findet meist in der vorletzten Schulwoche vor Beginn der Weihnachtsferien statt. Zur „Generalprobe“ am Vormittag sind alle übrigen Klassen eingeladen; zur Aufführung am Nachmittag kommen die Eltern der Kinder, die die Feier vorbereitet haben. Da die Veranstaltung in der Turnhalle stattfindet, kann aus Platz- und Sicherheitsgründen jedes Kind leider nur eine Person einladen. |
|
|
|
Arbeitsgemeinschaften tragen dazu bei, das pädagogisch gestaltete Schulleben zu bereichern, interessenweckende Lernsituationen zu schaffen, den Kindern Wahlmöglichkeiten zu eröffnen und so die Lernfreude zu erhöhen. Aus diesem Grunde wollen wir so viele Arbeitsgemeinschaften wie möglich (abhängig von der aktuellen Lehrersituation) anbieten. Vorrangig sollten folgende Arbeitsgemeinschaften weitergeführt werden: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach einem Probebesuch bei einer AG kann das Kind noch aussteigen. Anschließend ist die Teilnahme an einer AG bindend für ein halbes Jahr. Arbeitsgemeinschaften sind zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen. |
|
|
Entsprechende Lernorte sollen aufgesucht werden, um eine Verbindung zwischen Schule und Leben zu schaffen. So werden alle Sinne angesprochen (mehrkanaliges Lernen), wirklichkeitsgetreue Sachbegegnungen angeboten und insgesamt Lernmotivationen erhöht. Überschaubare Bereiche der Arbeitswelt, Zeugnisse der Kultur und der Geschichte sowie die Natur des Heimatraumes können als Lernorte genutzt werden. Als außerschulische Lernorte am Ort bieten sich für unsere Schule an: |
|
|
Heimatmuseum Raesfeld, Kirche (St. Martin / Lukas-Zentrum), Rathaus, Kläranlage, Schloss Raesfeld, Schlosskapelle, Tiergarten Raesfeld (Schlossteiche); Friedhof, jüdischer Friedhof, Issel-Quelle, Wellbrock-Quelle, Femeiche in Erle, aktuelle örtliche Ausstellungen (z.B. in der Volksbank), Unterrichtsgänge im Rahmen der Verkehrserziehung, Kreishaus
Borken, Archäologischer Park Xanten, Mülldeponie Hoxfeld,
Hamaland-Museum Vreden, Weitere Möglichkeiten siehe Kap. 21 „Schulfahrten/Schulwanderungen“ Ferner können am Ort befindliche Geschäfte und Einrichtungen wie Bäckereien, Feuerwehr, Banken, Tankstellen, Bauernhöfe etc. als außerschulische Lernorte dienen. Weitere Ideen und Anregungen von Seiten der Eltern werden begrüßt. |
|
|
|
Nicht allein durch die 3 wöchentlichen Sportstunden und die Neugestaltung des Schulhofes im Sommer 1999 soll Bewegung in den Schulalltag der Kinder gelangen. Auch regelmäßige Bewegungsaufgaben und -spiele im Unterricht sollen den Bewegungshunger der Kinder stillen und zu einem leistungsfördernden Wechsel von Ruhe und Bewegung im Tagesrhythmus führen. |
|
|
Seit April 1999 ist unsere Schule mit einem Computerraum mit 16 vernetzten PCs ausgestattet. Der Computer dient als Unterrichtsmedium, das stark motiviert und sehr gut individuell differenzieren kann. Es werden keine „EDV-Kurse“ angeboten, bei denen der Computer Inhalt des Unterrichts ist; EDV-Kenntnisse erlangen die Kinder vielmehr nebenher, wenn sie mit diesem Arbeitsmittel an anderen Themen arbeiten. |
|
|
Die vorhandene Software erlaubt den Einsatz der PCs in allen Jahrgängen und in nahezu allen Fächern. Künftig sollen darüber hinaus PC-Arbeitsplätze in den Klassenräumen geschaffen werden. Dazu hofft die Schule, dass Eltern und Betriebe, die Computer ausrangieren, diese der Schule anbieten (PCs ab Typ Pentium). Seit Sommer 2000 stellt sich die Schule mit einer eigenen Homepage im Internet vor. |
|
|
|
Für die ausländischen Schülerinnen und Schüler unserer Schule bieten wir einen Förderunterricht „Deutsch als Zweitsprache“ (von den Kindern „Deutschkurs“ genannt) an. Der Unterricht wird von dafür speziell ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern aus unserem Kollegium erteilt. Der „Deutschkurs“ findet zusätzlich oder parallel zum Sprache-Unterricht der beteiligten Klassen statt, so dass die ausländischen Schüler von Anfang an am Regelunterricht ihrer Klasse teilnehmen können. |
|
|
|
Vor den Sommerferien wird für die Eltern der Schulneulinge ein Elternabend durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen ausführliche Schulweginformationen und allgemeine Hinweise für den Schulanfang. Die Schulneulinge werden am 2. Schultag des neuen Schuljahres eingeschult. Vorher findet ein ökumenischer Gottesdienst statt. |
|
|
Die Schulneulinge versammeln sich mit ihren Eltern in der Pausenhalle zu einer kleinen Feier mit einem Spiel, gestaltet von einer Klasse der 4. Jahrgangsstufe und mit Liedern, die vom Chor gesungen werden. Dadurch soll der 1. Schultag zu einem erlebnisreichen und schönen Tag werden, der auch erste "Ängste" bei Schüler/innen und Eltern abbaut. Danach gehen die Kinder mit ihren Eltern in ihren Klassenraum. Nachdem Klassenlehrer(in) und Schüler/-innen eine Zeit lang allein waren, nehmen die Eltern ihre Kinder wieder mit nach Hause. In der 14-tägigen Anfangsphase soll der Unterricht vorwiegend von dem/der jeweiligen Klassenlehrer/-in erteilt werden. |
||
|
|
Wir bieten zweimal im Jahr Elternsprechtage an, in der Regel Mitte bis Ende November und vor den Osterferien. Für die 4. Schuljahre wird der Sprechtag vor den Osterferien auf Ende Januar vorgezogen, da im Februar die Anmeldungen zur weiterführenden Schule anstehen. Nach vorheriger Absprache sind darüber hinaus jederzeit Gespräche mit den Lehrern/-innen möglich. |
|
|
Die Fahrschüler unserer Schule besuchen die Klassen 1a, 2a, 3a und 4a. Die Busfahrkarten werden den Kindern zu Beginn des Schuljahres von dem/der Klassenlehrer/-in ausgehändigt. Der Schulbus hält direkt am Schulgelände an der Bushaltestelle „Zum Esch“. Mittags werden die Kinder dort beim Warten auf den Bus von einem Lehrer / einer Lehrerin beaufsichtigt. |
|
|
|
Im jährlichen Wechsel sind als gemeinsame Schulveranstaltung folgende Aktivitäten vorgesehen: |
|
|
|
|
Der Drei-Jahres-Rhythmus wird gewählt, damit jede Jahrgangsstufe innerhalb der Grundschulzeit bei einer anderen Aktivität gefordert ist. Am Freitag nach Weiberfastnacht haben die Kinder die Möglichkeit, in der Schule Karneval zu feiern. Weihnachten: (siehe Kap. „Adventsfeiern“ bzw. „Nikolausbesuch“) |
|
|
|
Der Förderunterricht dient dazu:
Der Förderunterricht wird im Klassenverband oder in Gruppen erteilt und kann sich auf alle Fächer beziehen. |
|
|
Hausaufgaben dienen der Einübung und Anwendung des Gelernten oder der Vorbereitung neuer Inhalte. Außerdem sollen sie die Kinder schrittweise an selbständiges Arbeiten heranführen. Individuelle Hausaufgaben für einzelne Schüler oder Schülergruppen sind ebenso möglich wie auch freiwillige Hausaufgabenangebote. Hinsichtlich ihres Umfangs und Schwierigkeitsgrades sollten die Hausaufgaben so gestellt sein, dass sie von den Kindern in angemessener Zeit (1./2. Schuljahr: bis zu 30 min., 3./4. Schuljahr: max. 60 min.) und ohne fremde Hilfe angefertigt werden können. Wenn ein Kind die Hausaufgaben nicht selbständig in dieser Zeitvorgabe erledigen kann, sind der Abbruch der Hausaufgaben und eine kurze schriftliche Rückmeldung der Eltern an die Lehrkraft sinnvoll. |
|
|
|
|
Jeden Donnerstag in der Frühstückspause wird durch die Lehrer/-innen das Kakaogeld für die kommende Woche eingesammelt. |
||
|
Es
werden zur Zeit angeboten: |
(Bei einer 3- oder 4-Tage Woche verringert sich der Preis entsprechend.) |
|
|
Den Verkauf von Mineralwasser in der Klasse regeln einzelne Klassen in Eigenregie. Es wird darum gebeten, den Kindern abgezähltes Geld mitzugeben, um Zeitverlust und unnötiges Wechseln zu vermeiden. Die Kinder des 1. Schuljahres bekommen die Getränke in der 2. Schulwoche gratis. |
||
|
|
Das Kollegium setzt sich zurzeit (14.08.2000) aus folgenden Lehrerinnen und Lehrern zusammen: Frau Kampschulte,
Frau Cluse, Frau Penassa und Frau Brand Frau Knabe,
Frau
Elskamp, Herr Ciethier und Herr Loker Frau
Jünck, Frau Looks, Frau Weide, Frau Gutberlet und Frau Behrendt Frau
Refflinghaus, Frau Horbach, Frau Pallas, Herr Grömping und Frau Halfmann als weitere Lehrkräfte: Herr Fischer (Rektor), Frau Fasselt, Herr Schwarze und Frau Gutschow (z.Zt. Sabbatjahr) Zum
Kollegium gehören außerdem zurzeit drei Lehramtsanwärter/-innen: Unser Hausmeister heißt Herr Benning, die Sekretärin Frau Kraft. |
|
|
Grundlage der Leistungsbeurteilung sind die Anforderungen der Richtlinien und Lehrpläne. Insbesondere im ersten und zweiten Schuljahr wird dabei auch der individuelle Lernfortschritt der Kinder berücksichtigt. |
|
|
|
In den Klassen 1 und 2 werden die Leistungen der Schülerinnen und Schüler ohne Verwendung von Notenstufen beschrieben. Zur Feststellung des individuellen Lernfortschritts können kurze schriftliche Übungen durchgeführt werden. Als Leistung werden nicht nur Ergebnisse, sondern auch Anstrengungen und Lernfortschritte bewertet. In den Klassen 3 und 4 werden die schriftlichen Arbeiten zur Leistungsfeststellung in den Fächern Mathematik und Sprache mit Noten bewertet. |
|
Für sämtliche Lernbereiche und Fächer gibt es schriftlich festgelegte Absprachen des Lehrerkollegiums über die Leistungsmessung und -bewertung, insbesondere für die schriftlichen Arbeiten. |
|
|
|
Für Kinder mit einer sogenannten „Lese-Rechtschreibschwäche“ (LRS) bieten wir bei Bedarf einen klassenübergreifenden Förderunterricht an. Die Teilnahme an diesem Förderunterricht wird auf dem Zeugnis vermerkt. Diese Schüler bekommen im 3. und 4. Schuljahr zwar Zeugnisnoten im Lesen und Rechtschreiben, sie sind aber nicht ausschlaggebend bei der Versetzungsentscheidung. |
|
|
Zu Nikolaus besuchen die Kinder an dem entsprechenden Schultag jahrgangsstufenweise den Nikolaus. Die Nikolausveranstaltung dient der Brauchtumspflege, sie wird im Religionsunterricht entsprechend vorgestellt. Von den einzelnen Klassen werden Lieder und Gedichte o. ä. vorbereitet. |
|
|
|
Die Rechte der Eltern ergeben sich aus dem Schulmitwirkungsgesetz (à nachzulesen unter dem entsprechenden Stichwort). Die Eltern haben auch Pflichten. Diese resultieren aus dem Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schulen. |
|
|
1. Die Erziehungsberechtigten unterstützen die Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie tragen dafür Sorge, dass der Schüler seine schulischen Pflichten erfüllt, insbesondere am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen regelmäßig teilnimmt und die Ordnung in der Schule einhält. (s. ASchO § 40, 1) |
|
|
2. Bei Krankheiten oder sonstigen unvorhergesehenen Verhinderungsgründen benachrichtigen die Erziehungsberechtigten spätestens am 2. Tag die Schule. Die Entschuldigung erfolgt hinterher mit Angabe der Fehlzeiten und des Grundes in der Regel schriftlich. Nur in dringenden Fällen soll die Meldung telefonisch erfolgen. |
|
|
Beurlaubungen müssen rechtzeitig bei der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer, vor und nach den Ferien schriftlich bei der Schulleitung unter Angabe des Grundes beantragt werden. |
|
|
|
a) Morgengebet Da unsere Schule eine katholische Grundschule ist, soll der Unterricht mit einem Gebet in beliebiger Form beginnen. |
|
|
b) Schulgottesdienst Katholischer Schulgottesdienst wird mittwochs in der 1. Stunde im Musikraum gehalten, und zwar in der Regel am 1. Mittwoch des Monats für den 3. Jahrgang und am 3. Mittwoch für den 4.Jahrgang. Der Gottesdienst wird im Rahmen des Religionsunterrichtes jeweils von einer Klasse vorbereitet. Nach Absprache kann der Gottesdienst auch in der Kirche bzw. Schlosskapelle stattfinden. |
|
|
In
unregelmäßigen Abständen werden auch evangelische Schulgottesdienste
gefeiert. c) Kontaktstunde In allen Jahrgängen gibt es regelmäßige Kontaktstunden zur katholischen und evangelischen Kirche. |
|
|
|
Katholischer
Religionsunterricht findet in allen Klassen statt. Die evangelischen SchülerInnen
werden zu Lerngruppen klassenübergreifend - ggf. auch jahrgangsübergreifend
- zusammengefasst. Auf Antrag der Eltern können die Kinder auch vom Religionsunterricht befreit werden oder am Religionsunterricht einer anderen Konfession teilnehmen. |
|
|
Die Schulkonferenz beschließt über die Neuanschaffung von Schulbüchern. Pro Kind stehen der Grundschule bis zu 53 DM für Unterrichtswerke zur Verfügung. Zwei Drittel dieses Betrages werden im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes von der Gemeinde übernommen; ein Drittel müssen die Eltern zahlen. |
|
|
Gekaufte Bücher bleiben Eigentum der Kinder. Sie sind häufig Verbrauchsmaterial, d.h. in ihnen wird gearbeitet und geschrieben. Die meisten anderen Bücher werden über mehrere Jahre von der Schule ausgeliehen. Sie sollen deshalb besonders pfleglich behandelt werden (à Schutzumschläge!). Bücher, die durch Eigenverschulden unbrauchbar geworden sind, müssen ersetzt werden. |
|
|
|
Wenn es um Dinge geht, die eine einzelne Klasse betreffen, sind alle Eltern dieser Klasse im Rahmen der Klassenpflegschaft beteiligt. Zu Beginn eines jeden Schuljahres wählen die Erziehungsberechtigten jeder Klasse im Rahmen des ersten Elternabends die/den Vorsitzende/n der Klassenpflegschaft. Die Wahl findet innerhalb der ersten drei Schulwochen statt und ist geheim. Die Amtszeit dauert jeweils ein Jahr, eine Wiederwahl ist möglich. Die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften bilden die Schulpflegschaft. Sie vertritt die Interessen aller Eltern in der Schule. Die Schulpflegschaft wählt auch die Elternvertreter/innen für die Schulkonferenz. Sie ist das zentrale Beschlussorgan der Schule mit weitreichender Entscheidungsbefugnis für grundsätzliche Fragen, die die ganze Schule betreffen (Welche Schulbücher sollen angeschafft werden? Wofür soll das Geld verwendet werden, das die Schule jährlich vom Schulträger bekommt? usw.). Die Schulkonferenz der Grundschulen besteht zur Hälfte aus Vertretern der Eltern, zur anderen Hälfte aus Vertretern der Lehrerinnen und Lehrer. |
|
|
|
| In unserer Schule ist es üblich, folgende Schulfahrten durchzuführen: |
|
|
| 1. Jahrgang | Wanderungen in Raesfeld | |
| 2. Jahrgang: | Fahrt zu einem Tierpark; z.B. Zoo Rheine, Vogelpark Metelen | |
| 3./4. Jahrgang: |
Ÿ Rundfahrt durch den Kreis Borken |
|
|
Ÿ Museumsfahrten (z. B. Hamalandmuseum Vreden, Textilmuseum Bocholt, Glockenmuseum Gescher, Bergbaumuseum Bochum, Freilichtmuseum Hagen, Ÿ Archäologischer Park Xanten) Ÿ Ausflüge (z. B. Anholter Schweiz, Burgers Zoo Arnheim) |
||
|
Es können pro Schuljahr maximal: eine mehrtägige Fahrt mit zwei Übernachtungen und zwei Tagesfahrten oder vier Tagesfahrten durchgeführt werden, sonst muss durch eine geheime Abstimmung die Einwilligung jedes Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Ein beliebtes Ziel für eine mehrtägige Fahrt ist z. B. die Jugendherberge Groß-Reken. |
||
|
|
|
Jedes Jahr wird ein gemeinsames Leichtathletik-Sportfest der Jahrgangsstufen 2 bis 4 an der Sportanlage „Zum Michael“ ausgetragen (Bundesjugendspiele). Die Siegerehrung sollte eine Gemeinschaftsveranstaltung sein. Allen Schülern und Schülerinnen werden mindestens Teilnehmerurkunden ausgehändigt. Die Durchführung eines Gerätturnen- oder Schwimm-Sportfestes bleibt den Sportlehrern/Sportlehrerinnen der einzelnen Klassen überlassen. Parallel
zum Leichtathletik-Sportfest der Jahrgangsstufen 2 bis 4 trägt das In die Organisation und die Gestaltung des Ablaufs werden u. U. Eltern einbezogen. |
|
|
Der Sportförderunterricht ist ein Hilfsangebot für Kinder mit leichten Haltungsschwächen oder Koordinationsstörungen. Die Kinder sollen gekräftigt werden, um leichte Haltungsschwächen zu korrigieren. Die Koordinationsfähigkeit der Schüler soll durch häufiges Training mit Handgeräten (Bälle, Reifen etc.) gefördert werden. Bei der Einschulungsuntersuchung entscheidet der untersuchende Arzt darüber, ob ein Kind am Sportförderunterricht teilnehmen soll. Der Sportförderunterricht findet zweimal wöchentlich als zusätzlicher Unterricht statt. Der Fachlehrer entscheidet über die Dauer der Teilnahme; sie beträgt mindestens ein Schuljahr. |
|
|
Verabschiedung der vierten Schuljahre Eltern, Schüler/innen und Lehrer/innen gestalten klassenweise eine Abschlussveranstaltung. Am letzten Schultag werden die Kinder der vierten Schuljahre von ihren Mitschülern/Mitschülerinnen und Lehrern/Lehrerinnen verabschiedet. |
|
|
Verfahren für den Übergang in weiterführende Schulen 1.
Informationsabend der Schulleitung am Anfang des 4. Schuljahres 2. Einzelberatung an den Elternsprechtagen im November/Dezember 3.
Abschließende Einzelberatung am zweiten Elternsprechtag des
4.Schuljahres 4. Schriftlich begründete Empfehlung zur Wahl der Schulform als Anlage zum Halbjahreszeugnis 5.
Anmeldung an den weiterführenden Schulen |
|
|
|
An unserer Schule wird die Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht angeboten, um die Situation von Kindern berufstätiger Eltern oder Alleinerziehender zu erleichtern. Nähere Informationen erteilen - die 1. Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Betreuung von Kindern an der St.-Sebastian-Schule, |
|
|
Frau Irmgard Siemen, Tel.: 0 28 65 / 87 43 sowie |
|
|
- die Betreuungskräfte |
Frau
Sabine Kroll, Tel.: 0 28 65 / 10 390 (Schule) bzw. 60 13 07 (priv.), |
|
|
Während der gesamten Schulzeit sind alle Kinder unfallversichert. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht nur auf die Dauer des Unterrichts (einschließlich der Pausen), sondern auch auf den vorgeschriebenen Schulweg und auf besondere Schulveranstaltungen wie Ausflüge und Besichtigungen. Eine Unfallanzeige durch die Schule muss immer dann erfolgen, wenn ein Kind auf Grund eines Unfalls oder einer Verletzung den Arzt aufsuchen musste. Schulwegeunfälle sollten sofort dem Sekretariat oder der Schulleitung gemeldet werden. |
|
|
Die regulären Unterrichtszeiten an unserer Schule gliedern den Schulvormittag wie folgt: |
|||||
|
|
|||||
|
Unterrichts- und Pausenzeiten können jedoch davon abweichen, um den Bedürfnissen der Schüler oder fachlichen Notwendigkeiten zu entsprechen. Bei starkem Regen werden die Pausen unter Aufsicht in den Klassenräumen verbracht. Die Unterrichtsverteilung richtet sich nach der vom Kultusminister festgesetzten Stundentafel: |
|||||
| Klasse | |||||
| Lernbereich / Fach | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
|
|||||
|
Sprache Sachunterricht Mathematik Förderunterricht |
} | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 15-16 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|
Musik Kunst/Textilgestaltung |
} | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|
|
|||||
| Wochenstunden | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 24-25 | |
|
|
Schwerpunkt
der Verkehrserziehung im 1. Schuljahr soll die Schulwegsicherung
sein. Im 2. Schuljahr steht die Beherrschung
des Fahrrads im Vordergrund. |
|
|
Unsere Schule nimmt in der Regel am jährlichen Wettbewerb "Könner auf zwei Rädern" teil. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung auf Kreisebene, bei der es in erster Linie auf Geschicklichkeit und Sicherheit auf dem Fahrrad ankommt. Ein Schüler jeder Klasse vertritt unsere Schule bei diesem überregionalen Wettbewerb in Borken. |
|
| Im 3. und 4. Schuljahr findet an unserer Schule die Vorbereitung auf die Radfahrprüfung statt. | |
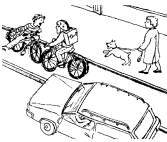 |
Die Radfahrprüfung Die Schüler sollen durch die Radfahrprüfung befähigt werden, sich mit dem Fahrrad in ihrer näheren Umgebung verkehrsgerecht und sicher zu bewegen. Die Verantwortung für die Verkehrserziehung liegt in erster Linie bei den Eltern. Die Schule wirkt nur unterstützend mit. |
|
a) Die Radfahrübungen für das 1. und 2. Schuljahr finden im Schonraum der Schule statt. b) Im 3. Schuljahr werden die wichtigsten Grundregeln im Sachunterricht intensiv theoretisch und praktisch erarbeitet.. Die Eltern werden über die Vorbereitung, Durchführung und Notwendigkeit der Radfahrprüfung informiert. Sie müssen ihr Einverständnis zur Teilnahme ihres Kindes an der Radfahrprüfung schriftlich erklären. Am Ende des 3. Schuljahres findet eine weitere Informationsveranstaltung statt, zu der die Verkehrspolizei eingeladen wird. Dabei wird auch das Prüfungsverfahren besprochen. c) Im 4. Schuljahr sollen die Eltern unter Anleitung der Schule und der Polizei durchschnittlich einmal pro Monat vormittags in der Verkehrswirklichkeit mit ihren Kindern üben (ca. 8 - 10 Übungseinheiten). Jeder Vater bzw. jede Mutter soll höchstens mit 2 Kindern fahren. Bei jedem Treffen wird eine Übung schwerpunktmäßig durchgeführt. Prüfung |
|
|
a) Theoretische Prüfung mit einem Fragebogen b) Praktische Prüfung mit Unterstützung von Polizei und Eltern. Bei bestandener Prüfung erhalten die Kinder einen "Radfahrführerschein". Das Bestehen der Radfahrprüfung wird auf dem Zeugnis vermerkt. |
|
|
|
Die Kinder der Klassen 1 und 2 erhalten jeweils am Ende des Schuljahres Zeugnisse, die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 halbjährlich. Die Zeugnisse der Klassen 1 bis 3 sind in Berichtsform geschrieben. Da unsere Schulkonferenz keinen anderweitigen Beschluss gefasst hat, erhalten neben den Zeugnissen der Klasse 4 auch die Zeugnisse des 3. Jahrgangs Noten. |
|
|